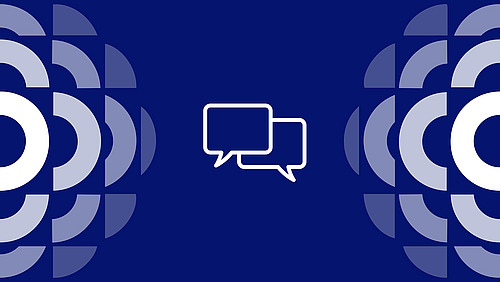B4 | Moscheen und die Produktion von Zugehörigkeit
B4 | Moscheen und die Produktion von Zugehörigkeit
Das religionssoziologisch ausgerichtete Teilprojekt B4 untersucht, auf welche Weise Moscheen neben der religiösen auch lokale, nationale und transnationale Zugehörigkeiten produzieren und damit als wirkmächtige migrationsgesellschaftliche Kristallisationspunkte hervortreten. Moscheen werden dabei als lokale und zugleich transnationale Infrastrukturen verstanden, die an der Produktion von ›transnationalen Communities‹ beteiligt sind, also Formen der ›Vergemeinschaftung‹ zwischen und über verschiedene Nationalstaaten hinweg
Das Teilprojekt richtet den Fokus auf türkisch-deutsche Moscheen in Deutschland. Diese mobilisieren verschiedene Identitätskategorien und produzieren Zugehörigkeiten nicht nur zu lokalen (religiösen) Communities, sondern auch zum (imaginierten) Herkunftsland Türkei, um türkisch-nationale bzw. türkisch-muslimische Loyalitäten aufrechtzuerhalten oder auszubauen. Außerdem beeinflussen sie die räumliche Mobilität ihrer Gemeindemitglieder.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Geschlecht, wobei untersucht wird, wie das Zugehörigkeitsgefühl junger Frauen in diesen Räumen geprägt wird. Die wachsende Diversität innerhalb der Moscheegemeinde verleiht den Geschlechterrollen und Familienstrukturen neue Bedeutungen. Das Projekt zielt darauf ab, zu erforschen, wie Geschlecht von jungen Frauen verhandelt und performt wird und wie ihr Zugehörigkeitsgefühl dadurch geformt wird.
Das Projekt untersucht, wie Moscheen hierbei mit einer Vielzahl von Akteuren kooperieren und konkurrieren – innerhalb des islamisch-religiösen Feldes (z.B. mit anderen Moscheegemeinden und -verbänden) wie außerhalb (z.B. mit Schulen, Sportvereinen, politischen Akteuren, Medien, Familien, migrantischen Communities etc.). Um diese Aushandlungen und Konflikte um Zugehörigkeiten erfassen zu können, greift das Teilprojekt auf Pierre Bourdieus Theorie des religiösen Feldes als forschungsleitenden Ansatz zurück. Damit werden sowohl die Machtkämpfe um die Deutungshoheit über Religion und Zugehörigkeit erklärbar als auch die Mechanismen der Herausbildung von Positionen im islamisch-religiösen Feld.
Empirisch nimmt das Teilprojekt eine Moschee in den Blick, die Mitglied der türkisch-islamischen Dachorganisationen DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.) ist. Mithilfe einer umfangreichen ethnographischen Feldforschung wird das komplexe Geflecht verschiedener Kategorien der Zugehörigkeit und ihrer Aushandlung mit ihren je spezifischen Dynamiken, Kräften und Konstellationen in der und durch die Moscheegemeinde aufgeschlüsselt. Die sich wandelnden und teilweise konflikthaften Bezüge und Bindungen der Moschee (für eine DITIB-Moschee sind das u.a. der türkische Staat und die staatliche Religionsbehörde) werden auf ihre Bedeutung für die Produktion von religiösen sowie lokalen, nationalen und transnationalen Zugehörigkeiten hin befragt.